Fokusthemen im vergangenen Jahr
Kapitel
Wirtschaftspolitik für Wissbegierige und Debattierfreudige
Im Podcast «Börsenstrasse Fünfzehn» diskutieren der Geldökonom Fabio Canetg und die Finanzunternehmerin Alexandra Janssen.

Mehr Finanzwissen fördert das Verständnis für das Funktionieren der Altersvorsorge: Alexandra Janssen und Fabio Canetg bringen «Nichtfinanzern» in ihrem Podcast Finanzfragen und Wirtschaftswissen kontrovers und unterhaltend näher.
Altersvorsorge in der Schweiz: der Vorteil der Diversifikation
«Die Rahmenbedingungen sollten weiterhin so gesetzt werden, dass eine Vielfalt von Angebot und Nachfrage bestehen bleibt und gesamtwirtschaftliche Klumpenrisiken unter allen Umständen vermieden werden.»

Hato Schmeiser, Institut für Versicherungswirtschaft, Universität St.Gallen.
Das Hochwasser 2005: ein Wendepunkt für die Versicherer
Vor 20 Jahren traf ein Jahrhunderthochwasser die Schweiz mit voller Wucht. Heute wären die Schäden um ein Drittel tiefer – dank präventiver Massnahmen und neuer Erkenntnisse aus der Forschung.

Dank Prävention versicherbar
Eine versicherbare und gut versicherte Schweiz ist eine prosperierende Schweiz. Die privaten Versicherer leisten dazu einen unverzichtbaren Beitrag.

Michèle Rodoni ist seit 2021 Vorstandsmitglied des SVV und CEO der Mobiliar. Sie hält einen Abschluss der Universität Lausanne als Aktuarin.
Cyberrisiken verstehen
Der Millennium-Bug zeigte, wie systemrelevant IT ist. Das Bewusstsein für Cyberrisiken ist gestiegen. Doch noch wissen viele nicht, wie sie sich richtig verhalten sollen. Es braucht eine Risikokultur.
Vor 25 Jahren offenbarte der Millennium-Bug die Systemrelevanz der IT. Heute ist sie allgegenwärtig. Dennoch ist der Umgang mit Cybersicherheit noch mangelhaft. Zwar gibt es positive Anzeichen. «KMU wissen heute, dass sie sich um das Thema kümmern müssen», sagt Jesús Pampín, Leiter Underwriting Sachversicherungen bei der Vaudoise. Angebote an Cyberversicherungen gibt es heute viele. Allerdings wüssten die Leute nicht immer, was sie abdecken. Pampín sieht darin eine Chance, gerade für Versicherungsberater und -beraterinnen und Broker, die in diesem Bereich eine Unterstützung und einen Mehrwert bieten können. Darüber hinaus ist den Unternehmen die Bedeutung der Präventionsmassnahmen bei Cyberversicherung eher bewusst als etwa bei einer Hausratversicherung. Sie wissen, dass Prävention entscheidend ist, um die potenziellen Auswirkungen von Cyberangriffen, die bis hin zur Betriebsschliessung gehen können, zu minimieren.

«KMU sind oft Ziel von Phishing-Attacken, Ransomware und Business Email Compromise (BEC)», sagt Dominique Trachsel, Leiterin Sensibilisierung und Prävention des Bundesamts für Cybersicherheit BACS. Die IT-Sicherheitsstrukturen von KMU sind meist weniger ausgeprägt als in grösseren Unternehmen. Das macht sie anfälliger für Angriffe. Bei Cyberangriffen werden oftmals menschliches Fehlverhalten oder Schwachstellen in IT-Systemen ausgenutzt. Einfache Sicherheitsmassnahmen wie regelmässige Backups und die Sensibilisierung von Mitarbeitenden können viel bewirken. «Massnahmen, die die betroffenen Zielgruppen direkt adressieren, können das Bewusstsein und die digitale Selbstverteidigung stärken», sagt sie. «Praxisorientierte Ratschläge, die sofort umgesetzt werden können, sind besonders effektiv.» Hier will das BACS stärker sensibilisieren. In der Zusammenarbeit mit dem SVV und weiteren Partnern will das BACS die Resilienz der Schweiz gegen Cyberrisiken mit einer Kampagne erhöhen. Diese soll das Bewusstsein für Cyberbedrohungen steigern und Nutzerinnen und Nutzer zu achtsamem Verhalten im Cyberraum anleiten. Die empfohlenen Massnahmen sind einfach umsetzbar: Dazu gehören unter anderem das Nutzen eines Passwortmanagers und wenn möglich eine Zwei-Faktor-Authentifizierung sowie das regelmässige Einspielen von Updates. Die Informationen der Kampagne sollen jede Nutzerin und jeden Nutzer befähigen, die Geräte und sich selbst im Internet zu schützen.
Regelmässige Upgrades, Backups und Passwortänderungen sowie aktuelle Antivirenprogramme sind Minimalanforderungen an die IT-Hygiene. «Diese Kultur der IT-Hygiene müssen wir bei allen durchsetzen», sagt Pampín, «in der Wirtschaft und der Gesellschaft». Das Thema gehöre in die Schule wie die Verkehrskunde. «Dort lernen alle den Umgang mit den Risiken im Verkehr und das Prinzip: ‹Warte, luege, lose, laufe› », sagt er.
Millennium-Bug
Weil Speicherplatz früher teuer war, speicherten IT-Programme die Jahreszahl im 20. Jahrhundert nur mit zwei Stellen. Sie verkürzten 1999 auf 99. Vor 25 Jahren wurde deswegen mit Katastrophenszenarien für den Jahrhundertwechsel gerechnet. Die Befürchtung war, dass Computer den Wechsel der Jahreszahlen von 99 auf 00 falsch interpretieren würden. Die mit Besorgnis erwarteten Szenarien um den Millennium-Bug blieben zwar aus, doch der Millennium-Bug zeigte, wie systemrelevant IT geworden war. Noch heute bergen digitale Monokulturen von Programmen, die weltweit im Einsatz sind, Risiken.
Heute Lernende, morgen CEO?
Juan Beer hat bei der Zurich sämtliche Stufen der Karriereleiter durchquert. Im Interview spricht er mit Seychelle Bailey, selbst Zurich-Lernende, über die Berufslehre, die der Grundstein zu seinem Werdegang war.

Rückblick auf 140 Jahre Versicherungsregulierung
140 Jahre Bundesaufsicht über das Versicherungswesen: ein Wunsch zum runden Geburtstag
Seit 1885 untersteht die Privatversicherung der Bundesaufsicht. Ihre Aufgabe ist die Aufsicht über die Versicherungsunternehmen und ab der Totalrevision des VAG von 2004 auch über die Versicherungsvermittler. Ergänzend zur Erweiterung des Beaufsichtigtenkreises hat sich im Laufe der Zeit neben der Aufsichtsfunktion eine Regulierungsfunktion entwickelt. Gesetzlich verankert ist diese seit 2007 mit dem Erlass des Finanzmarktaufsichtsgesetzes (FINMAG). In ihrer Aufsichtsfunktion ist die heutige FINMA dann tätig, wenn sie die Einhaltung der Finanzmarktgesetzgebung überprüft und deren Einhaltung durchsetzt. Die für die Aufsichtsfunktion notwendige Unabhängigkeit der FINMA ist gesetzlich garantiert (Art. 21 FINMAG). Die Regulierungsfunktion nimmt die FINMA wahr, wenn sie den Beaufsichtigten mittels Verordnungen generell-abstrakte Anforderungen auferlegt. Sie ist auch dann regulierend tätig, wenn sie sich mittels Rundschreiben zur Anwendung der Finanzmarktgesetzgebung äussert.
Gerade diese Regulierungsfunktion wirft Fragen institutioneller Natur auf:
Gewaltenteilung?
Die FINMA nimmt mit der Aufsicht eine rechtsanwendende Funktion wahr. Gleichzeitig übt sie mit der Regulierung eine rechtsetzende Funktion aus. Diese beiden Staatsfunktionen (Rechtsanwendung und Rechtsetzung) sind an sich gemäss Gewaltenteilungsprinzip auf verschiedene staatliche Organe aufzuteilen – um so gemäss Checks-and-Balances-Prinzip Schutz vor Übermacht einer Staatsfunktion zu bieten.
Konsultationsmechanismus?
Rechtsetzung ist primär Aufgabe der Legislative, des Parlaments. Allerdings gibt es auch eine der Legislative nachgelagerte Rechtsetzung durch die Exekutive, die Verordnungen des Bundesrates. Das Parlament bzw. seine Kommissionen verfügen jedoch über ein Konsultationsrecht bezüglich der Verordnungsentwürfe des Bundesrates. Sie können Empfehlungen zur Änderung der bundesrätlichen Verordnungsentwürfe abgeben. Mit einer Motion kann das Parlament zudem den Bundesrat beauftragen, eine Änderung eines Verordnungsentwurfes oder einer Verordnung vorzunehmen. Dieser legislative Konsultationsmechanismus und die Motionsmöglichkeit bezüglich der Rechtsetzung durch den Bundesrat spielt bei der Rechtsetzung durch die Aufsichtsbehörde FINMA nicht. Letztere findet abgekoppelt von einer Konsultationsmöglichkeit des Parlaments statt. Die FINMA orientiert sich dabei häufig an internationalen Standards. Allerdings werden auch diese von internationalen Behördennetzwerken, wie zum Beispiel der internationalen Vereinigung der Versicherungsaufsichtsbehörden, ohne Mitwirkung der Legislative entwickelt.
Geburtstagswunsch:
Im Interesse des Checks-and-Balances-Prinzips wäre ein legislativer Konsultationsmechanismus auf allen Stufen der Finanzmarktregulierung, auch bei Regulierungen der Aufsichtsbehörde FINMA, wünschenswert. In diesem Jahr begeht die Bundesaufsicht über das Versicherungswesen ihr 140-jähriges Jubiläum. Das Jubiläumsjahr könnte eine gute Gelegenheit sein, diese institutionellen Fragen zu vertiefen. Das Bundesamt für Justiz könnte dabei als das «rechtliche Gewissen» der Bundesverwaltung bei der Abklärung und gegebenenfalls für die Entwicklung eines Mechanismus dienen. Die für die Aufsichtsfunktion notwendige Unabhängigkeit der FINMA ist und bleibt garantiert. Ihre Unabhängigkeit würde dadurch nicht angetastet.

Franziska Streich ist Rechtsanwältin im Schweizerischen Versicherungsverband SVV und begleitet in dieser Funktion die Entwicklung der Versicherungsregulierung seit 25 Jahren.
Mehr als nur «Zusatz»
Der Blick in die Statistik erstaunt – nur rund acht Prozent des Gesundheitswesens werden von privaten Zusatzversicherungen finanziert. Andreas Schönenberger, CEO der Sanitas Krankenversicherung, erklärt, warum sie dennoch keine Nebenrolle spielen.

Andreas Schönenberger ist seit Februar 2019 CEO bei Sanitas, für die er bereits von 2015 bis 2019 im Verwaltungsrat aktiv war.
«Kritisches Denken bleibt unerlässlich»
Vom ersten Computer bis zur KI-gestützten Entscheidungsfindung: Die Versicherungsbranche war schon immer ein Vorreiter in Sachen Datenverwaltung.
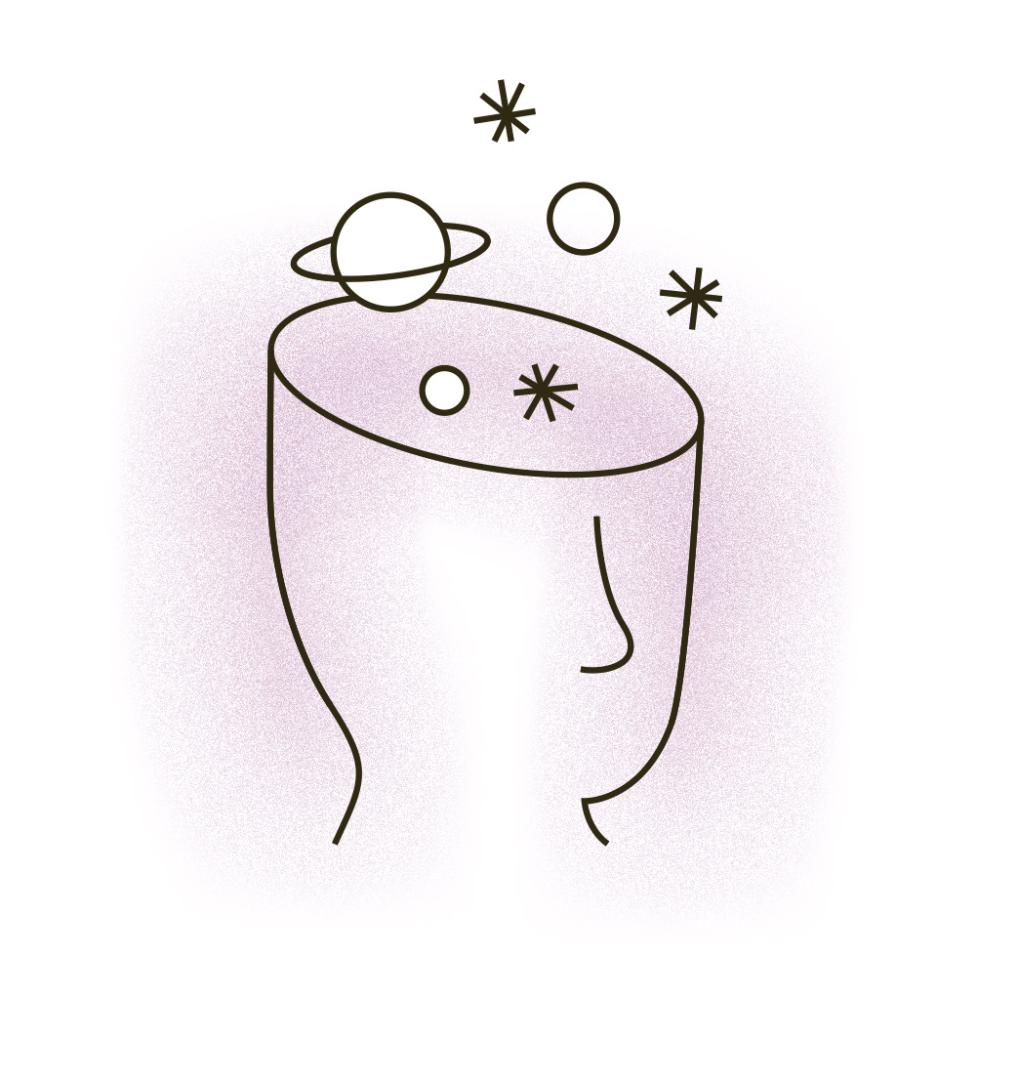
«Die Situation erinnert an den Dotcom-Boom»
Künstliche Intelligenz (KI) verändert die Art und Weise, wie Versicherungen arbeiten und wie sie mit ihren Kundinnen und Kunden interagieren. Der international renommierte Experte Evangelos Avramakis erklärt, warum die Branche nun zügig handeln sollte.

Evangelos Avramakis ist Leiter für Foresight, Intelligence & Development bei Swiss Re. Der 55-Jährige ist ein international anerkannter Experte für zukunftsweisende Marktentwicklungen, digitale Ökosysteme und innovative Geschäftsmodelle in der Versicherungsbranche.
Jahresmagazin 2025
-
Jubiläum und angepasste Strategie
Weiterlesen
-
Fokusthemen im vergangenen Jahr
Weiterlesen
-
Rechenschaftsbericht des SVV
Weiterlesen