
«Die Selbstvorsorge kann einem niemand abnehmen»
Wie hat die Schweiz das Corona-Jahr 2020 gemeistert? Und was bleibt von der Krise, wenn die Pandemie dereinst überwunden ist? Die Politikphilosophin Katja Gentinetta schaut im ersten Teil des zweiteiligen Interviews auf ein aussergewöhnliches Jahr zurück – und wagt im Gespräch mit Daniel Schriber einen Blick in die Zukunft.
Katja Gentinetta, wie haben Sie das Corona-Jahr erlebt?
Ich persönlich habe den Lockdown und die damit verbundene Ruhe und Entschleunigung sehr genossen. Gleichzeitig weiss ich, dass es ein Privileg ist, das so sagen zu können. Menschen, die aufgrund der Coronakrise um ihre Existenz bangen müssen, haben das Jahr natürlich anders erlebt. Eine Erfahrung teilt aber wohl das ganze Land: Wenn es erforderlich ist, sind wir in der Lage, sehr rasch auf neue Umstände zu reagieren und unseren Alltag anzupassen.

Blickt aus philosophischer Perspektive auf das Corona-Jahr zurück: Katja Gentinetta
Das zeigte sich zum Beispiel an den Schulen, die von heute auf morgen auf Fernunterricht umstellen mussten.
Richtig – was, wenn ich mit Bekannten spreche, die Kinder haben, unterschiedlich gut funktioniert hat. Aber auch in der Wirtschaft waren ähnliche Mechanismen festzustellen. Dinge, für die wir bisher kämpfen mussten, wurden auf einmal zur Normalität – allen voran die Möglichkeit, aus dem Homeoffice zu arbeiten oder Termine in Form von Videokonferenzen abzuhalten.
«Ich glaube, dass in Zukunft eine grössere Gelassenheit gegenüber neuen Arbeitsformen herrschen wird.»
Glauben Sie, dass wir auch in Zukunft vermehrt Videokonferenzen abhalten werden?
Da bin ich mir sehr sicher. Aufgrund der Erfahrungen in diesem Jahr scheint es mir selbstverständlich, dass es ab jetzt bei jeder Sitzung die Option gibt, sich persönlich oder online zu treffen. Auch glaube ich, dass in Zukunft eine grössere Gelassenheit gegenüber neuen Arbeitsformen herrschen wird. Dass es zum Beispiel ganz normal sein wird, einen Teil der Arbeitswoche von zu Hause aus zu arbeiten.
Lassen Sie uns über das «Big Picture» sprechen: Wie hat die Schweiz das Corona-Jahr 2020 gemeistert?
Bei dieser Frage gibt es für mich keine eindeutige Antwort. Während der ersten Welle im Frühling hat sich die Schweiz sehr gut geschlagen. Es war allen klar, dass wir diesen Lockdown gemeinsam durchstehen müssen, um die Krise zu überstehen. Solidarität war selbstverständlich. Nach einem ruhigen, ja fast schon normalen Sommer fehlte dieser Durchhaltewille im Herbst.
Die zweite Welle hat uns mit voller Wucht getroffen.
In der Tat bedeutend stärker. Dennoch verflog die «Lockdown-Euphorie» vom Frühling; stattdessen machte sich eine spürbare Müdigkeit breit. Die Menschen wollen einfach so rasch wie möglich wieder zurück in die Normalität. Das ist nachvollziehbar, aber auch nicht ungefährlich. Das Gesundheitswesen ist jetzt tatsächlich am Rande seiner Kräfte und Möglichkeiten.
«Die Sache mit der Eigenverantwortung hat nicht überall funktioniert.»
Wie bewerten Sie die Arbeit des Bundesrats?
Ich habe grundsätzlich grosse Achtung vor dem Krisenmanagement der Regierung. Gerade im Frühling, als noch sehr wenig über dieses neue Virus bekannt war, musste der Bundesrat aufgrund sehr unvollkommener Informationen weitreichende Entscheide treffen. Die Verantwortlichen lernten rasch dazu, korrigierten sich regelmässig und agierten stets zeitnah sowie mit Umsicht und auf der Basis bestehender Gesetze. Während andere Länder wie beispielsweise Frankreich einen totalen Lockdown verordneten, hatten wir in der Schweiz deutlich mehr Spielraum. Von uns wurde zu Recht erwartet, dass wir auch als Bürgerinnen und Bürger Verantwortung übernehmen.
Aber?
Die Sache mit der Eigenverantwortung – das heisst: der Verantwortung der Einzelnen für sich und die Allgemeinheit – hat leider nicht überall funktioniert. Offensichtlich brauchen viele Leute klare Vorschriften oder Verbote, um etwas zu tun oder zu lassen. Für ein Land, das die Eigenverantwortung so hoch hält und diese seit jeher für sich in Anspruch nimmt, hat mich das doch eher nachdenklich gestimmt.
Die Pandemie entpuppte sich als Belastungstest für den Föderalismus. Hat er diesen bestanden?
Da habe ich leider starke Zweifel. Im Frühjahr kritisierten die Kantone den Bund für sein eigenmächtiges Handeln. Als der Bund daraufhin den Ball an die Kantone zurückspielte und diese im Sommer und Frühherbst Verantwortung übernehmen sollten, kamen sehr rasch wieder Forderungen nach einheitlichen, nationalen Massnahmen auf. Es ist das eine, nach Eigenständigkeit, Autonomie und Entscheidungsfreiheit zu rufen. Etwas ganz anderes ist es aber, diese Verantwortung dann auch wirklich zu übernehmen. Das hat nicht überall funktioniert. Ich denke zum Beispiel daran, wie lange es dauerte, bis man sich in der Schweiz endlich einigermassen flächendeckend testen lassen konnte. Diese Krise hat auch die Grenzen unseres Systems offenbart.
Im Zusammenhang mit Corona stellen sich auch viele Fragen zur Versicherbarkeit. In welchen Bereichen braucht es diesbezüglich Anpassungen?
Offensichtlich wurde der Handlungsbedarf im Frühjahr bei der sogenannten Plattform-Ökonomie: Menschen ohne robuste Arbeitsverträge, deren Existenz jedoch von ihren Arbeitseinsätzen, beispielsweise für Uber Eats, abhängt, standen von einem Tag auf den andern vor dem Nichts. Die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts ist eine Realität, die durchaus auch Vorteile bringt. Umso wichtiger ist es, dass diese Arbeitsformen auch versichert sind, und zwar unabhängig davon, ob sie im Rahmen einer Festanstellung oder wie auch immer gearteten «Selbständigkeit» getätigt werden.
Oft heisst es, in der Schweiz herrsche eine Vollkaskomentalität. Sehen Sie das auch so?
Wir sind einen hohen Standard gewöhnt. Und je höher der Standard ist, umso mehr hat man zu verlieren. Zum einen sind wir obligatorisch über die Sozialversicherungen abgesichert. Darüber hinaus können wir uns freiwillig gegen alles Mögliche absichern. Und wir bezahlen ja auch dafür. Dennoch sind wir nicht gegen alles abgesichert. Darin liegt vermutlich die Schwierigkeit: Wir erwarten, dass auch im Notfall alles gleich gut funktioniert und jemand dafür sorgt. Das aber ist eine falsche Erwartungshaltung.
«Ich hätte erwartet, dass Unternehmen einen längeren Schnauf haben, wenn eine Krise ansteht.»
An wen denken Sie?
Ich denke unter anderem an jene Unternehmen, die gleich nach der ersten Ankündigung des Lockdowns nach dem Staat gerufen haben. Selbstverständlich hat der Staat diesen Lockdown verordnet; dennoch hätte ich erwartet, dass Unternehmen einen längeren Schnauf haben, wenn eine Krise ansteht. Die Selbstvorsorge kann einem niemand abnehmen. Allerdings hat sich die Schweiz, wie die jüngsten Zahlen zeigen, besser geschlagen als erwartet.
Wie ist es zu erklären, dass ein Land, dass die wirtschaftliche Freiheit und die Eigenständigkeit hochhält und sich seit Jahrzehnten so positioniert, beim ersten grossen Windstoss nach dem Staat ruft?
Wie gesagt: Der Staat hat den Lockdown verordnet. Dennoch hat er nicht sämtliche unternehmerischen Tätigkeiten unterbunden … Einige haben den Spielraum zu nutzen gewusst.
Haben wir als Gesellschaft die Eigenschaft verloren, mit unerwarteten Ereignissen und Risiken überlegt umgehen zu können?
Lassen Sie mich unterscheiden zwischen Risiken und Krisen. Risiken geht man bewusst ein, um – sofern das Kalkül die Möglichkeit enthält – einen Gewinn daraus zu ziehen. Krisen hingegen sind selten vorhersehbar, sondern brechen ohne Vorankündigung über einen herein. Derweil ein Risiko auch als kalkuliertes Abenteuer bezeichnet werden könnte, das aus freien Stücken eingegangen wird, erfordert eine Krise rasches Handeln und Entscheidungen bei hoher Unsicherheit. Das sind zwei sehr unterschiedliche Szenarien.
Das beantwortet aber die Frage noch nicht ganz: Was sagt uns die Coronakrise ganz allgemein über unseren Umgang mit Risiken?
Wir sind uns schlicht nicht mehr gewohnt, dass etwas nicht gut läuft. Gerade die Schweiz blieb in den vergangenen Jahrzehnten vor grossen Krisen verschont. Wir wogen uns in falscher Sicherheit und glaubten, es ginge immer so weiter. Wir haben uns längst an einen sehr hohen Lebensstandard gewöhnt. Nun müssen wir uns mit dem Gedanken anfreunden, dass dieser nicht einfach garantiert ist – und auch nicht vom Himmel fällt, wie wirtschaftsfeindliche Stimmen immer wieder suggerieren –, sondern den Einsatz von uns allen erfordert.
Zur Person:
Katja Gentinetta ist promovierte politische Philosophin. Sie arbeitet als Publizistin, Universitätsdozentin und Verwaltungsrätin. Sie schreibt als Wirtschaftskolumnistin in der «NZZ am Sonntag» und moderierte zusammen mit Chefredaktor Eric Gujer während vier Jahren die Sendung «NZZ TV Standpunkte». Sie ist unter anderem Mitglied des IKRK und begleitet Unternehmen und Institutionen in ihrer strategischen Entwicklung und bei gesellschaftspolitischen Herausforderungen. Sie publiziert und referiert im In- und Ausland regelmässig zu gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Themen. Katja Gentinetta ist 52 Jahre alt und wohnt mit ihrem Mann in Lenzburg.
Das könnte Sie auch interessieren
- Interview | 10. November 2020
«Eine Pandemieversicherung muss zu einem hohen Grad ein Solidarwerk werden»
Der Bund ist derzeit daran, zur Abfederung der wirtschaftlichen Auswirkungen von zukünftigen Pandemien eine sogenannte Poollösung zu prüfen. Ivo Menzinger hat an den möglichen Varianten mitgearbeitet.

- Listicle | 27. Januar 2021
Sechs Fragen und Antworten zum Grossrisiko Pandemie
Der Bund und die Versicherungswirtschaft suchen nach risikopartnerschaftlichen Lösungsansätzen, damit sich die wirtschaftlichen Folgen einer Pandemie in Zukunft besser abfedern lassen.
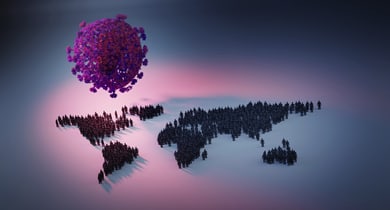
- Interview | 15. Januar 2021
«Die Coronakrise stellt das Verhältnis zwischen den Generationen auf die Probe»
Wie hat die Schweiz das Corona-Jahr 2020 gemeistert? Im zweiten Teil des Interviews mit Katja Gentinetta erläutert die Philosophin, welche Lehren die Schweiz aus der Coronakrise ziehen sollte.
